Fünfzehn Thesen zur vorläufigen Beantwortung der Frage, wie man in nahezu aussichtsloser Lage wenigstens eine andere Richtung einschlägt
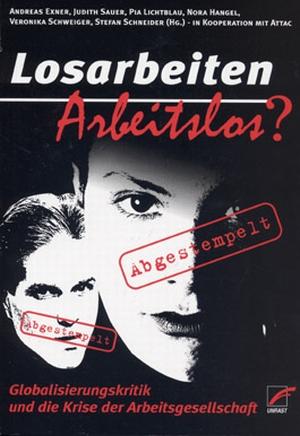 Diesen Text habe ich gemeinsam mit meinem langjährigen Weggefährten Werner Rätz geschrieben. In Begriff und Konzept der „Richtungsforderung“ bündelt er zugleich strategische und programmatische Überlegungen der Alterglobalisierungslinken und wurde auch deshalb mehrmals publiziert, als Buchbeitrag zuletzt in dem von Andreas Exner u.a. herausgegebenen Sammelband „Losarbeiten – Arbeitslos? Globalisierungskritik und die Krise der Arbeitsgesellschaft“ (Münster 2005). (Länger)
Diesen Text habe ich gemeinsam mit meinem langjährigen Weggefährten Werner Rätz geschrieben. In Begriff und Konzept der „Richtungsforderung“ bündelt er zugleich strategische und programmatische Überlegungen der Alterglobalisierungslinken und wurde auch deshalb mehrmals publiziert, als Buchbeitrag zuletzt in dem von Andreas Exner u.a. herausgegebenen Sammelband „Losarbeiten – Arbeitslos? Globalisierungskritik und die Krise der Arbeitsgesellschaft“ (Münster 2005). (Länger)
I. Systemüberwindung und kurzfristiger Kampf sind kein Widerspruch
Liegt eine revolutionäre Umbruchsituation nicht vor, sind konkrete soziale Kämpfe in der Regel unmittelbar auf die begrenzte Verbesserung der realen Lage der Betroffenen/Kämpfenden gerichtet oder, noch bescheidener, auf die Abwehr von Verschlechterungen. Nehmen radikale Linke an solchen Kämpfen teil, geraten sie schnell unter Verdacht, die „systemüberwindende“ Perspektive aufgegeben zu haben. Umgekehrt erweckt, wer ausschließlich auf den „großen Aufstand“ setzt, leicht den Eindruck der Gleichgültigkeit oder gar des Zynismus gegenüber den wirklichen Lebensumständen der Leute. Grundsätzlich gesehen ist der Streit zwischen einer langfristigen, „systemüberwindenden“ und einer kürzerfristigen, tagespolitischen Orientierung allerdings kaum zu entscheiden, folglich eine Sache des Bekenntnisses und wenigstens insofern müßig.
II. Wir können Realpolitik gegenwärtig nicht verändern
Die dennoch gerade in jüngster Zeit wieder in Mode gekommene Frage, ob wir denn den Kapitalismus abschaffen oder „nur“ reformieren wollen/sollen, macht uns heute allerdings noch hilfloser als dies früher schon der Fall war. Das hat vor allem pragmatische, mithin „realpolitische“ Gründe, sind wir doch gegenwärtig nicht einmal in der Lage, im Ziel begrenzte, „bloß“ tagespolitische Interventionen zum wirklichkeitsmächtigen Erfolg zu führen. Jüngster Beleg dafür war die im November 2003 aufgebrochene und im Sommer 2004 kulminierende breite gesellschaftliche Mobilisierung gegen die Hartz IV/Arbeitslosengeld II-Gesetze. Die seit Jahren stärksten Proteste in diesem ansonsten staats- und marktfrommen Land waren trotz ihres Umfangs und ihrer Dauer nicht im Ansatz in der Lage, die mit diesen Gesetzen noch einmal drastisch beschleunigte Absenkung des Lebensstandards und die fortgesetzte Rücknahme errungener sozialer Rechte auch nur aufzuhalten. Tatsächlich – auch das ist durch bittere Erfahrung gedeckt – ist selbst die Erhaltung einer halbwegs umfassenden und wenigstens die unumgänglichen Notwendigkeiten deckenden Gesundheitsversorgung – die in diesem Land zumindest den Inhaberinnen und Inhabern seiner Personalausweise schon einmal zustand – mittlerweile geradeso realistisch oder unrealistisch wie die Durchkämpfung der sozialen Revolution. Auf den Punkt gebracht: Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass wir nicht einmal in der Lage sind, an irgendeiner relevanten Stelle Realpolitik so zu verändern, dass für die Lebensverhältnisse der Menschen dadurch ein wesentlicher Unterschied erreicht wäre. Mehr noch: Wir waren und sind nicht einmal in der Lage, auch nur die Richtung von tagtäglicher Realpolitik irgendwie korrigieren oder verändern zu können.
III. Erklärungshegemonie gewinnt, wer vom Hier-und-Jetzt ausgeht
Einer um ihre reale Handlungsohnmacht aufgeklärten Linken kann es folglich weder um tagespolitisch-„reformistische“ noch um systemüberwindend-„revolutionäre“ Interventionen gehen, sondern zunächst einmal nur darum, die beide Optionen versperrende neoliberale Hegemonie im Denken, in der öffentlichen Wahrnehmung und der öffentlichen Debatte in diesem Land zu brechen, besser gesagt: wenigstens zu schwächen. Das ist nach Lage der Dinge ein langfristiges Projekt, dessen Ziele man mit Sicherheit nicht erreichen wird, wenn man realitätsferne Utopien im schlechten Sinne entwirft und dem eigenen Kopf Bilder eines zu erreichenden Zustands oder eines zu verwirklichenden Ideals entnimmt, nach denen sich die Wirklichkeit dann „richten“ soll. Wer tatsächlich die gesellschaftliche Erklärungshegemonie erringen will, muss zwar von einer anderen Welt reden, doch muss dies eine Welt sein, die in der heute herrschenden als deren Möglichkeit schon gegeben ist, die in ihr aussteht als ihre eigene Chance. Von der anderen Welt, die möglich ist, muss sichtbar sein, wie sie aus der heutigen werden und wie sie von den Leuten, die sie erkämpfen müssen, zunächst einmal gewollt werden kann.
IV. Unsere Forderungen sind mit den Alltagserfahrungen zu vermitteln
Eine gegenhegemoniale Intervention kann nun aber nicht darin liegen, sich auf die „grundsätzliche“ Ebene zu beschränken und den Leuten als den staunenden Adressaten eines umfassenden „Aufklärungsprojekts“ geradewegs zu erklären, wie und in welche Richtung man denn gesellschaftliche Entwicklungen „eigentlich“ denken müsste. Zurecht und zum Glück nämlich konfrontieren gerade die Leute, durch die, mit denen und für die eine andere Welt möglich werden kann, ein solches Projekt mit ihren unmittelbaren Bedürfnissen und Anliegen. Folglich muss die gegenhegemoniale Intervention trotz des realistischen Verzichts selbst auf ein tagespolitisch beschränktes Ziel auch das in den Blick nehmen, was man alltagssprachlich „die nächsten Dinge des Lebens“ nennt. Ein Beispiel nur: Zurecht beschränkte sich die Attac-Kampagne zur „Gesundheitsreform“ im realpolitisch aussichtslosen Widerstand gegen die Liquidierung der bisherigen öffentlichen Gesundheitsversorgung darauf, eben eine solche einzufordern, und dies für alle, das heißt auch und gerade für die, denen die Illegalisierung ihres Aufenthalts in Deutschland den Zugang zu Gesundheit zumindest enorm erschwert. Mit dem selben Recht beschränken wir uns – in der gegenhegemonialen Intention, das Mögliche plausibel zu machen – auf die notwendig hinzutretende, wenn auch realpolitisch gleichermaßen chancenlose Forderung, Gesundheit für alle durch Hinzuziehung sämtlicher Einkommen einschließlich der Unternehmensgewinne finanzieren zu wollen/zu können. Wie eine solche Gesundheitsversorgung im Gesetzestext auszuformulieren und ein solches Finanzierungsmodell umzusetzen wären, muss uns nicht interessieren, weil entsprechende Vorschläge unsererseits sowieso nicht abgefragt werden. Das entbindet uns aber nicht von der Aufgabe, die Forderung nach einem gleichen Zugang aller zu Gesundheit einsehbar mit den Erfahrungen zu vermitteln, die die Leute beim letzten Arztbesuch oder Krankenhausaufenthalt machen mussten. Erst wenn das gelingt, wirkt das Gift gegenhegemonialer Zersetzung auch so weit, dass weitergehende Bedürfnisse – wie etwa die nach der Abschaffung krankmachender Verhältnisse – artikuliert werden können.
V. Wir müssen das Dilemma zwischen „Systemkritik“ und „Alltag“ aushalten
Noch deutlicher wurde das bei den Auseinandersetzungen um die Hartz IV/Arbeitslosengeld II-Gesetze, durch die Millionen von lange dauernder Armut bedroht werden. Weil die davon Betroffenen hier und jetzt Antworten haben wollen und tatsächlich kurzfristige Perspektiven, reale Hilfe brauchen, fordert die politische Wirklichkeit auch von uns die Auseinandersetzung mit derart „systemimmanenten“ Alltäglichkeiten. Dass die politischen Entscheider auf unsere Meinung pfeifen, befreit uns nicht aus dem damit eröffneten Dilemma: Auf der einen Seite stehen die Leute mit ihren konkreten Forderungen, mit ihren konkreten Ansprüchen etwa an Gesundheitsversorgung oder eine Mindestsicherung im tagtäglichen Überleben. Auf der anderen Seite stehen wir mit unseren Überlegungen, wie es „eigentlich“ sein müsste, und mit unserem Wissen, dass es so erst werden kann, wenn die große Zahl der Leute sich von der Orientierung auf eine Markt- und Konkurrenzgesellschaft löst.
VI. Dieses Dilemma kann produktiv werden
Unsere reale Einflusslosigkeit hindert uns daran, kurzfristige Lösungen einfach zu versprechen: Nicht einmal sozialarbeiterische „Auswege“ dürften realistisch sein, schon deshalb, weil wir gar nicht über Kapazitäten verfügen, solche anzubieten. Bleibt also nur die produktive Annahme des Dilemmas selbst, seine Verwandlung in eine politische Produktivkraft: Können wir Forderungen entwickeln, die die grundsätzliche Richtung benennen, in die wir Gesellschaft bewegen und radikal verändern wollen, und die gleichzeitig Elemente liefern, um im Alltag Maßnahmen zu bestimmen, die die Lebensverhältnisse unmittelbar verbessern?
VII. Es ist genug für alle da
Im Attac-Schwerpunkt „GenugfürAlle“ haben wir uns deshalb zunächst auf einen generellen Grundsatz geeinigt, aus dem sich drei solche Richtungsforderungen ergeben. Dieser Grundsatz lautet: Es gibt ein Recht auf ein gutes Leben für alle. Jeder Mensch hat, nur weil es ihn und sie gibt, einfach aufgrund seiner und ihrer Existenz, das Recht auf ein gutes Leben, auf ein Leben, das Teilhabe am materiellen und symbolischen gesellschaftlichen Reichtum ermöglicht. Das muss sich niemand verdienen, nicht durch Arbeit, nicht durch Wohlverhalten, durch nichts. Dem stehen keine Pflichten gegenüber, denn selbstverständlich gibt es Rechte ohne Pflichten, auch wenn uns ein ehemaliger und ein noch amtierender Bundeskanzler das Gegenteil erzählen wollen. Ihr Zynismus ist hinreichend bekannt.: Das Recht auf ein Leben in Würde gewinnt man jedoch nicht erst, wenn man irgendjemandes Bedingungen erfüllt. Auch gesellschaftliche Teilhabe ist als solche unbedingtes Menschenrecht. Und: Es ist genug da, sie allen zu ermöglichen. Deshalb heißt dieser Schwerpunkt „Es ist genug für alle da“.
VIII. Ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle ist zu fordern
Ein gutes Leben für alle wird in unserer Gesellschaft, in allen modernen kapitalistischen Gesellschaften aber nur möglich, wenn Menschen über das dazu nötige Einkommen verfügen. Ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle ist deshalb die erste Richtungsforderung, die wir stellen müssen. Dieses Einkommen muss ausreichend sein, damit der Anspruch auf Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eingelöst wird. Es wäre in einem breiten Diskussionsprozess näher zu bestimmen, wie Teilhabe sich genau buchstabiert, aber es geht dabei stets und zwingend um mehr als um das nackte Überleben. Opernbesuch, Internetzugang, Bücher und das Brot vom Biobäcker müssen selbstverständlich drin sein. (Auch der Anspruch auf staatliche Infrastrukturleistungen, wie etwa Kinderbetreuung und alles andere, das die Reproduktion gewährleistet, muss selbstverständlich bestehen bleiben.) Um ein solches Grundeinkommen für alle zu erreichen, können eine ganze Reihe von konkreten Schritten benannt werden. Dazu gehört zuerst die Zurückweisung des gerade laufenden Generalangriffs auf soziale Sicherung insgesamt. Dazu gehört die Gestaltung von umfassender sozialer Daseinsvorsorge als öffentliche Aufgabe. Dazu gehört – zumindest bis zur Verwirklichung eines bedingungslosen Grundeinkommens – auch ein Mindestlohn für Arbeit, der Teilhabe sichert.
Diese Richtungsforderung und ihr Ausgangspunkt – wir wollen eine Gesellschaft, in der allen Leuten tatsächlich die Möglichkeiten zur Verfügung stehen, ein gutes Leben zu führen – gibt uns nicht nur konkrete Elemente an die Hand, mit denen wir Armutsentwicklungen zurückweisen können. Sie eröffnet uns auch die Möglichkeit einer grundsätzlichen Auseinandersetzung mit dem ideologischen Kern des Neoliberalismus und der kapitalistischen Ökonomie überhaupt. Alle bürgerliche Volkswirtschaft definiert Ökonomie als Verwaltung des Mangels. Wer ein bedingungsloses Grundeinkommen fordert, behauptet damit, dass genug für alle da ist. Dabei geht es nicht darum, dass materielle oder symbolische Ressourcen in ihrer Menge unbegrenzt wären. Es geht vielmehr um eine generelle Sicht auf die Dinge, um das, was manche der Revoltierenden von 1968 die „Umkehr der Perspektive“ nannten: darum, erst einmal zu lernen, gemeinsam von sich selbst auszugehen und darin den entscheidenden Maßstab der Gerechtigkeit zu gewinnen, das heißt, das eigene und zugleich das gute Leben aller und jedes und jeder einzelnen dem „Wohl und Wehe des Vaterlands“ oder, was in neoliberaler Façon dasselbe ist, der „Zukunftsfähigkeit des Standorts im globalen Wettbewerb“ vorzuziehen. Dazu müssen jede Predigt zum Verzicht und in ein und demselben Zug die Verhetzung zur Konkurrenz aller gegen alle zurückgewiesen werden.
IX. Unsere Antworten müssen von der Peripherie ausgehen
Wir müssen, wenn wir den Anspruch auf ein gutes Leben für alle auch nur halbwegs ernst nehmen wollen, als zweites sehen, dass ein solcher Anspruch niemals innergesellschaftlich bzw. nationalstaatlich realisiert werden kann. Das ist tatsächlich auch eine moralische Frage, denn es gibt kein Recht, den eigenen Wohlstand auf Kosten der Armut Dritter, im für uns hier gegebenen Fall auf Kosten der Menschen des globalen Südens zu sichern. Entscheidender als die moralische ist allerdings die politische und ökonomische Dimension des Umstands, dass man das Armutsproblem national gar nicht lösen kann: Armut wird international produziert, entwickelt und ergibt sich aus der Tatsache, dass wir in einer kapitalistisch globalisierten Welt leben, deren Logik und Dynamik jeden national beschränkten Rahmen schon gesprengt hat. Zugleich und eben deshalb kann die Frage nach der Überwindung der Armut zureichend nicht vom Zentrum, sondern nur von der Peripherie her beantwortet werden. Mit einer Predigt zum Verzicht darf das, man wird sehen warum, nicht verwechselt werden.
X. Ein Schuldenerlass für den globalen Süden ist notwendig
Es ist heute allerdings nicht ganz leicht zu bestimmen, wo genau in einer sich global sehr schnell ändernden Welt Zentrum und Peripherie sind. Das schematische Modell „des Nordens“ und „des Südens“ ist sicher überholt: Es gibt Gewinner und Verliererinnen auf beiden Hälften des Globus, wenn auch nach wie vor nicht gleichmäßig überall. Die Milliarde Menschen, die weltweit hungert, Hunderte von Millionen Flüchtlingen und die Bewohner/innen der (bürger-)kriegszerrütteten Gesellschaften gehören sicher zu den Verlierer/innen, und sie finden sich nach wie vor im Wesentlichen im Süden. Als zweite Richtungsforderung, im internationalen Rahmen von den Rändern her gedacht, ergibt sich damit die Notwendigkeit einer Umkehr der Ressourcen- und Stoffströme von Nord nach Süd. Ein Erlass der Schulden der arm gemachten Länder des Südens zum Beispiel würde die Möglichkeiten der Menschen dort erheblich verändern, sinnvolle und erreichbare Kampfziele neu ins Auge zu fassen.
XI. Der Kampf gegen die Illegalisierung ist grundlegend
Wenn wir „Süden“ und „Norden“ heute nicht mehr als Begriffe benutzen können, die Eindeutiges über die geographische Verteilung von Reichtum und Armut aussagen, dann kann auch ein Konzept von Richtungsforderungen die Welt nicht einfach in zwei Teile aufteilen, sondern muss den Blick wieder zurück zum Ausgangspunkt richten. Jeweils auch innergesellschaftlich muss das Armutsproblem von den Rändern, von der Peripherie her gedacht werden. Dabei geht es nicht nur darum, dass viele vom Recht auf ein gutes Leben ausgegrenzt werden und es Leute gibt, für die das mehr oder weniger systematisch, schon aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe gilt. Dieses Problem ist mit der ersten Richtungsforderung ja durchaus schon angesprochen. Es geht vielmehr auch darum, dass die Menschen die Grenzen zwischen dem Süden und dem Norden, dem Osten und dem Westen unablässig auch ganz real überschreiten. Die Existenz und zugleich Autonomie der Migration – worunter nicht eine Autonomie von Migrantinnen und Migranten zu verstehen ist – kann trotz aller „Abschottung“ der reichen Zentren nicht unterbunden werden; sie ist und bleibt die erfolgreichste soziale Bewegung. Ein umfassender „Stopp der Zuwanderung“ ist auch gar nicht gewollt, selbst wenn die rassistischen Hetzreden diesen Eindruck nahe legen. Denn immerhin gelingt es, vermittels des Regimes über die illegalisierten Migrant/innen zunehmenden Druck auf die Arbeits- und Lebensbedingungen aller anderen auszuüben. An den illegalisierten Leuten wird ausprobiert, wie weit man die sozialen, die rechtlichen, und auch die ökonomischen Standards noch absenken kann, um die Flexibilisierung und Mobilisierung von Arbeitskraft voranzutreiben. Die Lebensbedingungen der offiziell hier gar nicht „vorhandenen“ Leute sind die, die tendenziell auch den anderen drohen: Diejenigen „am unteren Ende der Gesellschaft“ sind deshalb nicht die Konkurrenz derer, die scheinbar noch knapp darüber liegen, sondern vielmehr jene, die da unbedingt raus müssen, wenn die anderen nicht ebenfalls dorthin geraten wollen. Wer die Illegalisierung nicht mitdenkt, akzeptiert damit eine Spaltung in der Gesellschaft, an der auch alle anderen Kämpfe immer wieder scheitern werden. Sich das klar zu machen und daraus die politischen Konsequenzen zu ziehen, schließt allerdings ein, sich vor stilisierten Vorstellungen „der Opfer“ zu hüten: Kein Migrationsregime kann die Autonomie der Migration selbst abschaffen, wozu natürlich stets gehört, dass es immer auch Illegalisierte gibt, die ihre Wege zu einem guten Leben und zum Recht auf ein solches Leben zumindest ein Stück weit, zumindest phasenweise schon gefunden haben. Und das ist auch gut so. Deshalb muss, lange Rede kurzer Sinn, wer ein gutes Leben für alle will, unbedingt dafür eintreten, dass alle Leute dort, wo sie sind, auch gleiche Rechte haben. Das Recht auf Rechte ist die dritte Richtungsforderung und zugleich die Voraussetzung aller weiteren Kämpfe. Auch hier gibt es neben der Richtungsforderung selbst eine ganze Reihe von weiteren konkreten Schritten, von der Sozialversicherung für polnische Erntehelfer/innen bis zum Recht aller, die hier sind, ihren Aufenthalt hier legalisieren zu können, wenn sie das wollen.
XII. Richtungsforderungen ermöglichen gemeinsame Kämpfe
Was vom Recht auf Rechte als einer Richtungsforderung gilt, gilt von jeder anderen Richtungsforderung auch: Sie ermöglicht eine ganze Reihe von kleinen Schritten und Folgeschritten, ohne dass mit dem jeweils unternommenen Schritt die Gesamtforderung schon eingelöst wäre. Letztlich weisen Richtungsforderungen – deshalb heißen sie so – in der Perspektive ihrer vollständigen Durchsetzung über diese Gesellschaft hinaus. Zugleich ermöglichen sie gemeinsame Kämpfe um jeweils aktuelle Maßnahmen, ohne dass die „Systemüberwindung“ dabei eine von jeder und jedem zu unterschreibende Teilnahmevoraussetzung wäre.
XIII. Zerstörungstechnologien sind abzuschaffen
Auch der Neoliberalismus kennt durchaus den Gedanken, dass es ein Recht auf ein gutes Leben gibt. In dessen neoliberaler Fassung setzt sich ein gutes Leben erst und allein am Markt durch, dann nämlich, wenn dessen Dynamiken radikal freigesetzt werden. An uns ergeht deshalb die Aufforderung, uns mit allen Mitteln für den Markt zu optimieren. Zu diesen Mitteln gehören zunehmend auch die Bio-, Gen- und Nanotechnologien – und zwar als Mittel, ein optimal verwertbares Leben, ja schließlich einen auf immer neue Verwertbarkeit optimierten „Neuen Menschen“ zu produzieren. Wie die Atom- und natürlich die Militärtechnologien sind die Biotechnologien gerade in der rückhaltlos entgrenzten Steigerung und Freisetzung von „Produktivität“ Technologien der Destruktion; einer Destruktion, die sich zuletzt auf das gesamte Leben richtet. Deshalb zielt eine vierte Richtungsforderung auf die Abschaffung aller Destruktivtechnologien und nimmt darin Impulse auf, die sich in den Kämpfen gegen die Atomkraft ebenso ausdrückten wie im Widerstand gegen den imperialistischen Krieg. Dabei verstehen wir unter Destruktivtechnologien solche, die absehbar unter keinen gesellschaftlichen Bedingungen beherrschbar sein werden und deshalb der Tendenz nach das Leben selbst bedrohen. Doch weil es menschliche Gesellschaften nur als solche gibt, die immer schon auch technologisch mit sich und der organischen wie anorganischen Natur experimentieren, kann der Unterschied von Produktiv- und Destruktivtechnologien nicht vorab, sondern nur im Kampf um das technologisch Mögliche und Unmögliche entschieden werden.
XIV. Alle Richtungsforderungen gehören zusammen
Zusammenfassend: Wir können heute letztlich nur Richtungsforderungen stellen. Davon kann es viele geben, die vier hier beschriebenen gehören eng zusammen und können nicht einzeln gedacht werden. Ihre wesentliche Klammer ist das Recht auf ein gutes Leben. Dies hat eine innergesellschaftliche, eine internationale und eine von dort her wieder in die eigene Gesellschaft zurück gewandte Dimension und kann zureichend nur von der Peripherie der gesellschaftlichen Zusammenhänge her gedacht werden. Sie bewähren sich in ihrer Fähigkeit, den Eigensinn unscheinbarer, „kleinerer“, aus dem Alltag eines jeden und einer jeden entspringender Forderungen zu stärken und zu vertiefen, indem sie ihnen die Perspektive ihrer fortgesetzten Radikalisierung eröffnen.
XV. Wir sollten auf Überraschungen gefasst sein
Selbstvorbehalt. Die Geschichte sozialer Kämpfe wird von plötzlichen Sprüngen markiert, in denen gleichsam von einem Tag auf den anderen „alles“ anders wird – oder zu werden scheint. Das vielleicht dramatischste Beispiel der letzten Jahrzehnte war dafür das plötzliche Ende der DDR und des realen Sozialismus. Auch die Etablierung der „globalisierungskritischen Bewegung“ im Zuge der Proteste in Seattle und Genua zählt dazu. Auf die Plötzlichkeit solcher Sprünge und Brüche vorbereitet zu sein, empfiehlt sich gerade für die, deren politischer Entwurf sich realistischerweise auf lange Fristen einstellt. Dabei sind Sprünge auf der Oberfläche von solchen in der Tiefe des Geschehens zu unterscheiden. Die offenbare Zersetzung der politischen Konstellation des deutschen Staates, aber auch anderer Staaten des europäischen Zentrums und der sie tragenden Eliten kann, das lehren die jüngsten Ereignisse, plötzlich und rapide voran schreiten. Insofern gilt es, sich in kurzer und mittlerer Frist auf allerlei Verwerfungen einzustellen, die uns mindestens zweierlei abverlangen werden: Offenheit und Ironie. An der strukturellen Grenze aller Nationalstaaten, die heute endlich und endgültig nicht mehr als Räume der sozialen Emanzipation, nicht einmal als solche relativer sozialer Sicherheit gedacht werden können, ändern solche Sprünge wenig. Dies umso mehr, wenn sie aus der Perspektive der Peripherie bewertet werden. Was das im einzelnen heißt, ist zum Glück nicht Sache eines Thesenpapiers, sondern der politischen Phantasie sozialer Bewegung.
