Annäherung an einen linken Radikalismus nach dem Ende der Utopie.
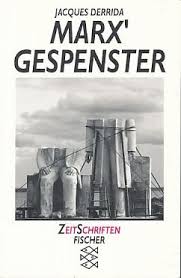 Gerade in der Radikalität seiner „Dekonstruktion“ schien Jacques Derrida über Jahre hinweg fern jeder außerphilosophischen Praxis zu sein. Tatsächlich aber war er Zeit seines Lebens Aktivist einer radikalen Politik in erster Person, ausgefochten stets an den vordersten Frontlinien der Neuen Linken. Unübersehbar wurde das aber erst, als er zum Protagonisten der kleinen Schar von Philosoph*innen wurde, die den Begriff und die Sache des Kommunismus nach 1989 wieder sprechbar gemacht haben. Auf den Punkt kam sein politisches Philosophieren nicht zufällig in seiner Unterscheidung von Recht und Gerechtigkeit. Ihr ist noch heute wenig hinzuzufügen. Mein Text dazu erschien im Herbst 2000 in analyse und kritik. (Kurz)
Gerade in der Radikalität seiner „Dekonstruktion“ schien Jacques Derrida über Jahre hinweg fern jeder außerphilosophischen Praxis zu sein. Tatsächlich aber war er Zeit seines Lebens Aktivist einer radikalen Politik in erster Person, ausgefochten stets an den vordersten Frontlinien der Neuen Linken. Unübersehbar wurde das aber erst, als er zum Protagonisten der kleinen Schar von Philosoph*innen wurde, die den Begriff und die Sache des Kommunismus nach 1989 wieder sprechbar gemacht haben. Auf den Punkt kam sein politisches Philosophieren nicht zufällig in seiner Unterscheidung von Recht und Gerechtigkeit. Ihr ist noch heute wenig hinzuzufügen. Mein Text dazu erschien im Herbst 2000 in analyse und kritik. (Kurz)
Eine Erörterung des widersprüchlichen Verhältnisses der Linken zum Recht, zum Gesetz und zur Gerechtigkeit führt notwendig in eines ihrer zentralen Probleme. Zur Debatte steht, ob die Fundamentalkritik der kapitalistischen Vergesellschaftung – und d.h. zugleich die Kritik jedes systemimmanenten Reformprojekts – notwendig die Utopie einer gänzlich anderen – sozialistischen, kommunistischen oder anarchistischen – Gesellschaft einschließt. Wäre dies nicht der Fall, stünde die Linke vor der Aufgabe einer radikalen Reformulierung ihres Politikverständnisses. Dieses wäre dann nicht mehr durch das Ziel des Übergangs von einer Herrschafts- und Gesellschaftsformation in eine andere bestimmt, sondern durch die unendliche Kritik von Herrschaft und Gesellschaft überhaupt. Eine solche wird beispielhaft in Jacques Derridas Dekonstruktion des Rechts im Namen unendlicher Gerechtigkeit versucht, deren Bedeutung für die Linke im folgenden mit Bezug auf den Kosovo-Krieg entwickelt wird.
I. Das Ungenügen des Gesetzes gegenüber der Gerechtigkeit
Schon früh formuliert die politische Philosophie Europas ein prinzipielles Ungenügen des Rechts bzw. der Fixierung der Gerechtigkeit in der Form des Gesetzes. Den Grund dafür benennt Platon wie folgt:
“Denn die Unähnlichkeit der Menschen und der Handlungen, und daß niemals nichts sozusagen Ruhe hält in den menschlichen Dingen, dies gestattet nicht, daß irgend eine Kunst irgend etwas für Alle und zu aller Zeit Einartiges hinstelle. (…) Das Gesetz aber sehen wir doch, daß es eben hiernach strebt, wie ein selbstgefälliger und ungelehriger Mensch, der nichts anderes will als nach seiner eigenen Anordnung tun und auch niemanden weiter anfragen lassen, auch nicht, wenn für jemanden etwas Neues besser ist außer der Ordnung, die er selbst festgestellt hat. (…) Unmöglich also kann sich zu dem niemals Einartigen das richtig verhalten, was durchaus einartig ist.”[i]
Platons Kritik richtet sich gegen die Gesetzlichkeit als solche. Diese will in der Form des Gesetzes Regeln zur Anwendung bringen, die ausnahmslos für alle Personen und Situationen gelten sollen. Das Gesetz macht bei gleichen Handlungen keinen Unterschied zwischen den handelnden Personen und setzt sich über Unterschiede des Ortes und der Zeit hinweg. Indem es alle gleich macht und unter allen Umständen gerecht sein will, muß das Gesetz den einzelnen gegenüber ungerecht sein, weil es weder ihren Motiven noch den einzigartigen Bedingungen ihrer singulären Existenz gerecht werden kann. Das Ungenügen des Gesetzes ist ein Ungenügen gegenüber der Gerechtigkeit, die es doch gerade durchsetzen will, in dem es sich jeder und jedem unter allen Umständen auferlegt.
Bei Platon begründet der Widerspruch von Gesetzlichkeit und Gerechtigkeit die autoritäre Utopie eines über dem Gesetz stehenden Philosophenkönigs, der der Gerechtigkeit nötigenfalls gegen das geltende Recht zu ihrem Recht verhilft. Diese Utopie ist noch heute die der politischen Rechten. Aus dem Ungenügen des Gesetzes resultieren aber auch die linken Utopien einer sozialistischen, kommunistischen oder anarchistischen Gesellschaft, in der das Gesetz vollständig in die Selbstbestimmung und Selbsttätigkeit der vergesellschafteten Individuen zurückgenommen ist. Das Gesetz wird hier nicht durch die übergesetzliche Souveränität eines einzelnen, sondern durch die der Gesellschaft selbst überschritten.
Daß beide Utopien – die der Herrschaft des Guten und die des Guten ohne Herrschaft – zwischenzeitlich grundsätzlich diskreditiert wurden, bedarf nach den sozialen Katastrophen des 20. Jahrhunderts keiner ausführlichen Begründung mehr und rechtfertigt insoweit die nachutopische Position einer Linken, deren Berufung auf das Recht weithin zum pragmatischen Ersatz für die utopische Idee vollständig realisierter Gerechtigkeit geworden ist. Der nachutopische Pragmatismus hat im Kosovo-Krieg allerdings doppelten Schiffbruch erlitten.
II. Kosovo – der Krieg des Rechts und der gerechte Krieg
Zu den erschreckendsten Begleiterscheinungen des Krieges gegen Jugoslawien gehört, daß es nirgends zu einem nennenswerten Widerstand gegen diesen Krieg kam. Daß die Reste der Antikriegs- und Solidaritätsbewegung der Propaganda der beteiligten Regierungen und der elektronischen Medien wenig entgegenzusetzen hatten, lag vor allem daran, daß es ihr Diskurs von Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie war, der das Dauerbombardement legitimieren sollte. Gegen diese infame Legitimationsstrategie argumentierte auch die Linke unter Berufung auf Recht und Gesetz, diesmal unter Berufung auf Völkerrecht und Grundgesetz, die von der NATO bzw. der Bundesregierung objektiv verletzt wurden. Im Streit zwischen Menschenrecht hier und Völkerrecht dort herrschte ein ideologisches Patt. Dieses wurde auch dadurch weiter verfestigt, daß sich sowohl das serbische Regime wie die Bandenchefs der UCK auf das Völkerrecht, nämlich einerseits auf das Recht auf territoriale Integrität, andererseits auf das Recht auf nationale Selbstbestimmung beriefen. Dem hatten insbesondere jene Linken nichts entgegenzusetzen, die durch die NATO-Aggression primär die Unverletzlichkeit nationalstaatlicher Souveränität – also wiederum einen Kernbestandteil des Völkerrechts – verletzt sahen.
Angesichts solcher Fallen muß zunächst ausdrücklich erinnert werden, daß ein linker Streit um Recht und Gerechtigkeit zuerst die Analyse der Machtverhältnisse voraussetzt, die die in Frage stehenden Rechtsverhältnisse bestimmen. Dabei sollte eine durchaus dogmatische Bestimmung wieder zur Geltung gebracht werden, nach der zur Minimaldefinition der Linken die kompromißlose Gegnerschaft zum imperialistischen Krieg gehört.
Tatsächlich eröffnet gerade der Kosovo-Krieg einen ersten Zugang zu einem adäquaten Begriff des zeitgenössischen Imperialismus. Was in Jugoslawien geschehen ist, ereignet sich auch anderswo und wird sich in Zukunft ausweiten. Weil der Globalisierungsprozeß der letzten 20 Jahre zu einer historisch nie zuvor gekannten Verarmung von Millionen und zur Desintegration ganzer Gesellschaften geführt hat, ist in den marginalisierten Weltregionen ein halbwegs gesichertes Überleben vielfach nur noch um den Preis einer gewaltbestimmten “Verwilderung der Konkurrenz” (Robert Kurz) möglich. Diese wird durch gnadenlose Machtkämpfe zwischen den jeweiligen Staatseliten und durch eine Ökonomie des Raubes auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens realisiert. Schon Mitte der 90er Jahre schätzte das UN-Flüchtlingskommissariat die Zahl der Menschen, die dabei vertrieben wurden oder ihr Überleben durch Migration zu sichern suchten, auf über 20 Millionen, vier Fünftel davon Frauen und Kinder. Noch heute gelingt es nur einer Minderheit, sich in die prosperierenden Archipele des Weltsystems zu retten; daß dies auch in Zukunft so bleibt, ist das primäre Ziel des gegenwärtigen Imperialismus, den Kurz deshalb treffend als “Sicherheits- und Ausgrenzungsimperialismus” bezeichnet: “Die von der universellen Marktwirtschaft selbst erzeugten Katastrophen sollen möglichst draußenbleiben. Von diesem Standpunkt aus müssen die ‘Flüchtlingsströme’ vor den westlichen Grenzen gestoppt und die Zusammenbruchsregionen auf Elendsniveau ‘befriedet’ werden.”[ii] Insofern besteht der Erfolg des Krieges gegen Jugoslawien denn auch darin, daß die vom Irak über die Türkei und den Balkan nach Italien führende “Südroute” der internationalen Migrationsbewegung unterbrochen und vermutlich dauerhaft unter Kontrolle gebracht werden konnte.
Allerdings meldet sich in der Erneuerung einer imperialismustheoretischen Kritik ein Dilemma, das dem einer ‘bloß’ normativ argumentierenden Kritik ebenbürtig ist. Die Schwäche der Antikriegsbewegung hat nämlich auch mit einer von normativen Fragen unberührten “antiimperialistischen” Tradition zu tun, mehr noch: damit, daß nicht wenigen Linken oder Ex-Linken der NATO-Krieg als Fortsetzung ihres früheren Antiimperialismus mit anderen, nämlich staatlichen Mitteln, erschien. Die Berufung der regierenden Menschenrechtskrieger auf ihre unverbrüchliche Treue zu dem, was sie in der Vietnam-, Nicaragua- und El Salvador-Solidarität gelernt haben wollen, ist nicht ganz von der Hand zu weisen-: gehörte doch die bedingungslose und bisweilen blinde Unterstützung der “unterdrückten Volksmassen” zum “Sieg im Volkskrieg” gegen “herrschende Cliquen” und ihre “Hintermänner” über Jahre hinweg zum guten Ton internationaler Solidarität. Wesentliches Motiv war und ist dabei die trotz allen ideologischen Verschiebungen fortwirkende Bejahung einer vorgeblich emanzipatorischen Qualität des bewaffneten Kampfes und ihre Überhöhung im Ideal des “gerechten Krieges”. Dieser setzt sich im Namen der Gerechtigkeit über alle Rechtsordnungen hinweg und rechtfertigt die faktische Ungerechtigkeit jeder Form der Gewalt als solcher. Die ideologische Figur weist in die dunkelsten Traditionen der Linken, der Arbeiterbewegung und der antikolonialen Befreiungsbewegungen zurück, in die vom militärischen Kalkül gegen das Recht gekehrte Gewalt bewaffnet kämpfender Fronten ebenso wie in die systematische Gewaltherrschaft einzelner staatssozialistischer Regime und deren Legitimation durch kommunistische Parteien oder linksradikale Organisationen. Gemeinsamer Nenner dieser ansonsten heterogenen Tradition ist die Verachtung des Rechts als eines ‘bloß’ ideologischen Überbaus bürgerlicher Herrschaft, zu dem die Linke nur ein taktisches Verhältnis haben könne. Dabei speist sich die Verachtung des Rechts aus zwei Quellen: aus der Tradition des “wissenschaftlichen Sozialismus”, für den sich Rechts- und Gerechtigkeitsfragen auf Machtfragen reduzierten, und aus der Tradition des utopischen Sozialismus, der das endliche Recht im Namen unendlicher Gerechtigkeit verwarf. Bei den regierenden Ex-Linken Schröder, Scharping, Fischer und Schmierer, aber auch in der Bejahung des Krieges durch zahllose andere, ansonsten integre Ex- und Noch-Linke vermischen sich Reste längst aufgegebener Gerechtigkeitsutopien mit dem nachutopischen Pragmatismus ihrer “reifen” Jahre. Dieser versteht den gerechten Krieg nicht mehr als Sache internationaler Solidarität im antikolonialen “Volkskrieg”, sondern als “humanitäre Intervention” des bewaffneten Arms der internationalen Zivilgesellschaft.
Im doppelten Dilemma des Kriegs der Rechte und des gerechten Krieges ist die Linke deshalb doch nicht allein auf die genaue Analyse der imperialistischen Machtverhältnisse, sondern auch auf den normativen, d.h. an Geltungsfragen orientierten Streit um Recht und Gerechtigkeit angewiesen. Das eine ist ohne das andere nicht zu haben.
III. Für eine Politisierung des Rechts
Im bereits in den siebziger Jahren einsetzenden Niedergang des im Mai 68 noch einmal erneuerten revolutionären Utopismus wird auch in der Linken eine theoretische Strömung rezipiert, die vor allem von französischen AutorInnen ausging. Den sog. “Poststrukturalisten” und “Dekonstruktivisten” ist bei allen z.T. erheblichen Unterschieden die Berufung auf die zweideutig-zwielichtigen deutschen Philosophen Friedrich Nietzsche und Martin Heidegger gemein.[iii] Obwohl sie zur “gauchistischen” Tradition einer radikal herrschaftskritischen Linken zählen, tragen sie unwillentlich nicht wenig zur Abwendung der 68er Generation von der eigenen linken Vergangenheit und somit zum Pragmatismus ex-linker “Realpolitik” bei. Dies lag an ihrer radikalen Kritik an zentralen Voraussetzungen der linken Tradition, vor allem an der Vorstellung der Geschichte als eines linear voranschreitenden Prozesses, in dem ein universales Subjekt der Menschheit zur Emanzipation seines “Gattungswesens” in einer vollständig gerechten Gesellschaft gelangt.
Daß die liberal-pragmatistische Rezeption der Poststrukturalisten sich einem Mißverständnis verdankte, wird spätestens Anfang der neunziger Jahre klar, als ausgerechnet Jacques Derrida – vorgeblich der unpolitischste und “versponnenste” Autor des Poststrukturalismus – dem immer schriller werdenden “antimarxistischen Konzert” entgegentritt, sich offen dem “kommunistischen Versprechen” verpflichtet und ausdrücklich erklärt, daß die Dekonstruktion “immer nur Sinn und Interesse gehabt hat als eine (…) versuchte Radikalisierung des Marxismus. (…) Deswegen habe ich vom marxistischen Gedächtnis und von der marxistischen Tradition der Dekonstruktion, von ihrem marxistischen ‘Geist’, gesprochen.”[iv]
Die dekonstruktive Radikalisierung des “kommunistischen Versprechens” hat Derrida in mehreren Schriften entwickelt, in deren Mittelpunkt eine erneuerte Fundamentalkritik der Gesetzlichkeit unter der Forderung nach unendlicher Gerechtigkeit steht.[v] Dabei gründet Derrida die theoretische Dekonstruktion des Rechts auf eine vortheoretische historische Bewegung: “Diese Gerechtigkeit, die kein Recht ist, ist die Bewegung der Dekonstruktion: sie ist im Recht und in der Geschichte des Rechts am Werk, in der politischen Geschichte und in der Geschichte überhaupt, bevor sie sich als jener Diskurs präsentiert, den man in der Akademie, in der modernen Kultur als ‘Dekonstruktivismus’ betitelt.”[vi]
Allerdings verwirft Derrida nicht nur den Pragmatismus einer Realpolitik, der das Recht von der prinzipiell unmäßigen Forderung unendlicher Gerechtigkeit entlasten will, sondern auch den Utopismus einer vollendet gerechten Gesellschaft. Exemplarisch realisiert Derrida dies in der Auseinandersetzung mit einem Autor, dem er in vieler Hinsicht nahesteht, nämlich mit Walter Benjamin. Dieser hat in dem Aufsatz ‘Kritik der Gewalt’ (1921) eine geschichtsphilosophische Rechtfertigung der außer- und antigesetzlichen revolutionären Gewalt und der Utopie einer Abschaffung der Gesetzlichkeit durch diese Gewalt versucht.[vii] Derrida zeigt, daß Benjamin in einem wesentlichen Punkt mit den Pragmatisten übereinkommt: Wie diese setzt er Gesetzlichkeit und Gerechtigkeit in ein äußerliches Verhältnis. Während unendliche Gerechtigkeit für die Pragmatisten ein ‘bloßes’ Ideal ist, nach dessen Verabschiedung sie sich allein am pragmatisch Möglichen orientieren, verortet Benjamins Utopismus die Forderung nach unendlicher Gerechtigkeit in der gesetzwidrigen Gewalt eines “proletarischen Generalstreiks”, der jede Form staatlichen Rechts beseitigt und die Gesetzeskraft in eine vollständig emanzipierte Gesellschaft zurücknimmt.
Gegen die vom Pragmatismus des endlichen Rechts und vom Utopismus der vollendeten Gerechtigkeit gleichermaßen vollzogene Trennung von Recht und Gerechtigkeit entdeckt Derrida “zwischen Recht und Gerechtigkeit ein zweideutiges und zweifelhaftes Gleiten”, das deren Entgegensetzung unterwandert. Dieses “Gleiten” zeigt sich im hermeneutischen, d.h. auslegenden Charakters des Rechts. Dabei geht Derrida in zwei Schritten vor.
Gegen die Reduktion des Rechts auf ein autonomes System ausformulierter Regeln und Normen verweist er darauf, daß Recht und Gesetz nur im Kontext rechtssetzender und rechtserhaltender Deutungen verständlich und angewendet werden können, und daß – im Gegensatz explizit zu Benjamin – Rechtssetzung und Rechtserhaltung nie grundsätzlich getrennt werden können. Jede Rechtssetzung ist zugleich ein Fortschreiben bisherigen Rechts, und jede Rechtserhaltung ist nicht bloß eine bloße Wiederholung, sondern stets eine Um- und Neu-Deutung des Gesetzes.
Im zweiten Schritt legt Derrida dar, daß und wie der stiftende und erhaltende Rechtsvollzug nicht allein auf den Gesetzestext zurückgeführt werden kann, weil sich in jeder Deutung des Rechts ein Gerechtigkeitsverlangen geltend macht, das in keiner Rechtsordnung erfüllt werden kann. Dieses Gerechtigkeitsverlangen hat seinen Ort aber nicht – wie Benjamin und die Utopisten unterstellen – in einem Außerhalb des Gesetzes, sondern in den besonderen Rechtsvollzügen, die das gegebene Recht auf ein neues Recht hin überschreiten. Das Setzen neuen Rechts im selbstüberschreitenden Vollzug des bisherigen Rechts gehört “weder zur Gerechtigkeit noch zum Recht. Dem einen oder dem anderen Raum gehört es nur in dem Maße an, in dem es die Grenzen des betreffenden Raums zum anderen hin öffnet.”[viii] Diesen Prozeß bezeichnet Derrida als ebenso antipragmatistische wie nachutopische “Politisierung des Rechts”: “Die Politisierung des Rechts ist ein endloser Prozeß, sie kann und darf aber niemals zu einem Abschluß kommen, eine totale Politisierung sein. Damit dies nicht wie eine Binsenweisheit oder etwas Triviales klingt, gilt es, folgende Konsequenz zu erkennen: Jedes Vorstoßen der Politisierung zwingt uns dazu, die Grundlagen des Rechts, die aus einer erfolgten Berechnung und Abgrenzung resultieren, erneut in Erwägung zu ziehen und folglich neu zu deuten. So hat es sich z.B. bei der Erklärung der Menschenrechte zugetragen, bei der Abschaffung der Sklaverei, im Zuge all jener Befreiungskämpfe, die statthaben und weiterhin statthaben werden, überall in der Welt, im Namen der Frauen und der Männer” (ebd.).
Tatsächlich tritt Derrida damit der von Pragmatismus und Utopismus abgesetzten dritten Linie eines radikalen, weil prinzipiell unbeschränkten Reformismus bei, dem Projekt einer, wie Christoph Menke sagt, “unendlichen Reform des Rechts.”[ix] Trotzdem wird seine Position erst dann klar, wenn man erkennt, wie er noch die radikalreformistische Idee einer unendlichen Annäherung an die Utopie vollendeter Gerechtigkeit – in Derridas Worten: einer möglichen totalen Politisierung des Rechts – verwirft. Denn der radikale Reformismus denkt die Gerechtigkeit von der Gleichheit her und kritisiert das geltende Recht aus der Erfahrung heraus, daß es nicht für alle gleichermaßen gerecht ist. Radikale Reformen überschreiten das bestehende Gesetz in einer nie zu vollendenden Annäherung an die vollständige Gleichheit aller, in der sich Recht und Gerechtigkeit in der steten Verbesserung des Gesetzes unendlich nahekommen sollen.[x]
Derrida hingegen denkt den Widerstreit zwischen Gerechtigkeit und Recht und das “zweideutige und zweifelhafte Gleiten” ihres Unterschieds und ihrer Zusammengehörigkeit nicht von der noch nicht realisierten Gleichheit, sondern vom Widerstreit zwischen dem Gesetz und den singulären Existenzen her: “Wie soll man den Akt der Justiz, der stets ein Besonderes in einer besonderen Lage betrifft, Individuen, Gruppen, unersetzbare Existenzen, mich, einen/den/als anderen, mit der Regel, der Norm, dem Wert oder dem Imperativ der Justiz in Einklang bringen, wenn diese zwangsläufig eine allgemeine Form aufweisen, mag es sich auch um eine Allgemeinheit handeln, die eine jeweils besondere Anwendung vorschreibt?”[xi] Macht man dies zum Ausgangspunkt für den Einspruch gegen das Gesetz, dann zielt die Forderung nach unendlicher Gerechtigkeit nicht auf die Vollendung der Politik in einer (vollständig oder möglichst) gerechten Gesellschaft der Freien und Gleichen, sondern auf die Unterbrechung der Politik, auf einen unendlichen Widerstand gegen die Politik, gegen das Recht, den Staat und jede staats- und rechtsförmig organisierte Zusammengehörigkeit der Gleichen vor den Anderen. Diese Subversion führt aber nicht in ein Jenseits des Rechts, sondern wirkt im Rechtsvollzug selbst – in der Umdeutung des geltenden Gesetzes im Namen des Rechts, für das zu kämpfen jetzt dringlich ist.
IV. Zurück ins Kosovo oder: Grenzen auf für alle!
Was haben die Dekonstruktion, die Politik der Dekonstruktion und die Dekonstruktion der Politik mit dem Kosovo zu tun und dem Dilemma des linken Streits um Recht und Gerechtigkeit? Derrida definiert die Dekonstruktion als “Aufgabe, die Geschichte, den Ursprung, den Sinn, will sagen die Grenzen der Begriffe der Gerechtigkeit, des Gesetzes, des Rechts, und die Grenzen der Werte, der Normen, der Vorschriften ins Gedächtnis zurückzurufen.”[xii] Bezieht man dies auf die im Kosovo-Krieg von allen Parteien in unterschiedlicher Weise in Anspruch genommenen Menschenrechte, so muß deren dekonstruktive Politisierung sie zunächst in ihrer ganzen Bandbreite ins Spiel bringen und deshalb jeden Versuch zurückweisen, sie im partikularen Interesse gegeneinander auszuspielen. Die gegebenen Rechte der Beteiligten müssen dann aber im Licht der Rechte gedeutet werden, durch die sie im besonderen Widerstreit von Recht und Gerechtigkeit, und das heißt im Einspruch und im Widerstand gegen die in ihrem Namen begründeten Politiken überschritten werden. In dekonstruktiver Perspektive erfolgt diese Überschreitung unter der Forderung nach unendlicher Gerechtigkeit, die sich stets “an das vielfältig Besondere, an die Besonderheit des Anderen richtet, unbeschadet oder gerade aufgrund ihres Anspruchs auf Universalität.”[xiii] Im Kosovo-Krieg ist dieser Andere, besser: sind diese Anderen ohne jeden Zweifel die von allen Seiten in ihrem Existenzrecht bedrohten Vertriebenen, MigrantInnen und Deserteure. Ihr Anspruch auf Gerechtigkeit ist es, der die Politisierung des Rechts zum Widerstand gegen die Politik selbst macht: “Unendlich ist diese Gerechtigkeit, weil sie sich nicht reduzieren, auf etwas zurückführen läßt, irreduktibel ist sie, weil sie dem Anderen gebührt, dem Anderen sich verdankt; dem Anderen verdankt sie sich, gebührt sie vor jedem Vertragsabschluß, da sie das Kommen des Anderen ist, dieses immer anderen Besonderen.”[xiv] Deshalb ist für Derrida das Recht, in dessen Licht alle anderen Rechte neu gedeutet werden müssen, das dem Anderen bedingungslos gebührende Gastrecht.[xv] Insofern deutet sich die praktische Konkretion einer dekonstruktiven Politisierung des Rechts in den Sätzen an, mit denen die autonome a.f.r.i.k.a.-gruppe in der Ausgabe 3 der Internetzeitung com.une.farce ihre “Thesen für einen neuen Anti-Militarismus” beschlossen hat:
“Wegweisend wäre vor allem eine Kampagne für die Öffnung der Grenzen für die Flüchtlinge gewesen. Der Aufruf „Break the logic of war! Desert! Open the borders!“ war ein Versuch hierfür. Eine breitere Auseinandersetzung darüber hätte offensichtlich werden lassen, wie humanitär diese Kriegsbefürworter tatsächlich sind. Es ist nicht der geniale ideologische Schachzug, und es sind auch nicht die Massen, an denen es uns mangelt. Es bedarf vielmehr neuer sozialer Netzwerke all derer, die sich in Widerspruch zu den herrschenden Verhältnissen setzen wollen. Hierfür benötigen wir einen langen Atem, eine außerordentliche Frustrationstoleranz und die Bereitschaft sich verwickeln zu lassen. Dabei sollten wir nicht selbst Sicherheits- und Ausgrenzungsmechanismen im Kleinen (re)produzieren, sondern die Fähigkeit entwickeln, ‚fuzzy networks‘ über ideologische Differenzen und unterschiedliche Motivationen hinweg zu knüpfen.”[xvi] Dabei liegt die Aktualität des “kommunistischen Versprechens” Derrida zufolge in der Verbindung einer radikalen theoretischen Kritik der bestehenden Macht- und Rechtsverhältnisse mit ihrer praktischen Dekonstruktion in einer universellen politischen Aktion, der Derrida in der besten und der dunkelsten marxistischen Tradition den Namen der “Internationale” gibt. Von dieser wird zu sagen sein, daß sie gegen die Politik, d.h. gegen die polis, d.h. gegen jede Gemeinschaft der Geichen, sei sie als Gemeinschaft des Blutes, der Sprache oder des Rechts bestimmt, das Recht des Anderen erkämpfen wird. Denn, um ein letztes Mal Derrida zu zitieren, “ein Versprechen muß versprechen, daß es gehalten wird, es muß versprechen, nicht ‘spirituell’ oder ‘abstrakt’ zu bleiben, sondern Ereignisse zu zeitigen, neue Formen des Handelns, der Praxis, der Organisation”[xvii].
Fußnoten
[i] Platon, Politikos, 294b,c.
[ii] Robert Kurz, jungle world vom 5.5. 99. Seiner Analyse kann m.E. auch dann zugestimmt werden, wenn die grundsätzlichen Annahmen der Krisentheorie nicht geteilt werden.
[iii] Neben Jacques Derrida gehören dazu Jean Baudrillard, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Felix Guattari, Luce Iruigaray, Jean-Luc Nancy u.a. Als “Poststrukturalisten” werden sie bezeichnet, sofern sie die politischen und moralischen Konsequenzen der strukturalistischen Methodologie – vor allem den Verzicht auf ein konstitutives ‘Subjekt’ – zur Voraussetzung ihres Diskurses machen. Der Ausdruck ‘Dekonstruktion’ geht auf Heidegger zurück.
[iv] Jacques Derrida, Marx’ Gespenster. Der Staat der Schuld, die Trauerarbeit und die neue Internationale. Frankfurt 1996, S. 149f.
[v] Dazu gehört neben ‘Marx’ Gespenster’ vor allem die Benjamin gewidmete Schrift ‘Gesetzeskraft. Der ‘mystische Grund der Autorität’, Ffm 1991, die Essays ‘Das andere Kap. Die vertagte Demokratie’, Ffm 1992, die ‘Politik der Freundschaft’, Ffm 2000 und der Nachruf auf E. Lévinas, ‘Adieu’, München 1999.
[vi] Gesetzeskraft, S. 52.
[vii] Vgl. Walter Benjamin, Kritik der Gewalt. In: Gesammelte Schriften Bd. II.1. Frankfurt 1977.
[viii] Gesetzeskraft, S. 58.
[ix] Christoph Menke, Für eine Politik der Dekonstruktion. In: Anselm Haverkamp, Gewalt und Gerechtigkeit. Derrida-Benjamin. Frankfurt 1994, S. 285.
[x] Dies gilt so freilich nur für den klassischen Radikalreformismus. André Gorz, Michel Foucault und Joachim Hirsch, die in unterschiedlicher Weise als ‘Radikalreformisten’ bezeichnet werden können bzw. sich selbst so bezeichnen, kommen der von Derrida vertretenen Position näher. Vgl. André Gorz, Abschied vom Proletariat. Reinbek 1983, S. 82f u. pass.; ders., Und jetzt – wohin?. Berlin 1991, S. 96f. u. pass.; Michel Foucault, Was ist Aufklärung? In: Eva Erdmann u.a.: Ethos der Moderne, S. 49ff.; Joachim Hirsch, Vom Sicherheitsstaat zum nationalen Wettbewerbsstaat. Berlin 1998, S. 105.
[xi] Gesetzeskraft, S. 35.
[xii] ebd. S. 40.
[xiii] ebd., 41. In der Betonung des Rechtsanspruchs der singulären Existenz vor der Gleichheit aller steht die Dekonstruktion dem Liberalismus nahe, von dem sie sich jedoch grundsätzlich unterscheidet, in dem sie die singuläre Existenz nicht vom (bürgerlichen) Individuum, sondern vom Anderen her denkt – “und sei es der Andere in mir”, wie Derrida ergänzt.
[xiv] Gesetzeskraft, S. 51.
[xv] Derridas eigenes politisches Engagement gilt in den letzten Jahren primär antirassistischen Initiativen wie denen der ‘sans papiers’.
[xvi] Autonome A.f.r.i.k.a.-Gruppe, Gegen wessen Kriege welchen Widerstand? In: com.une.farce no. 3, www.copyriot.com/unefarce.
[xvii] Marx’ Gespenster, S. 145.
